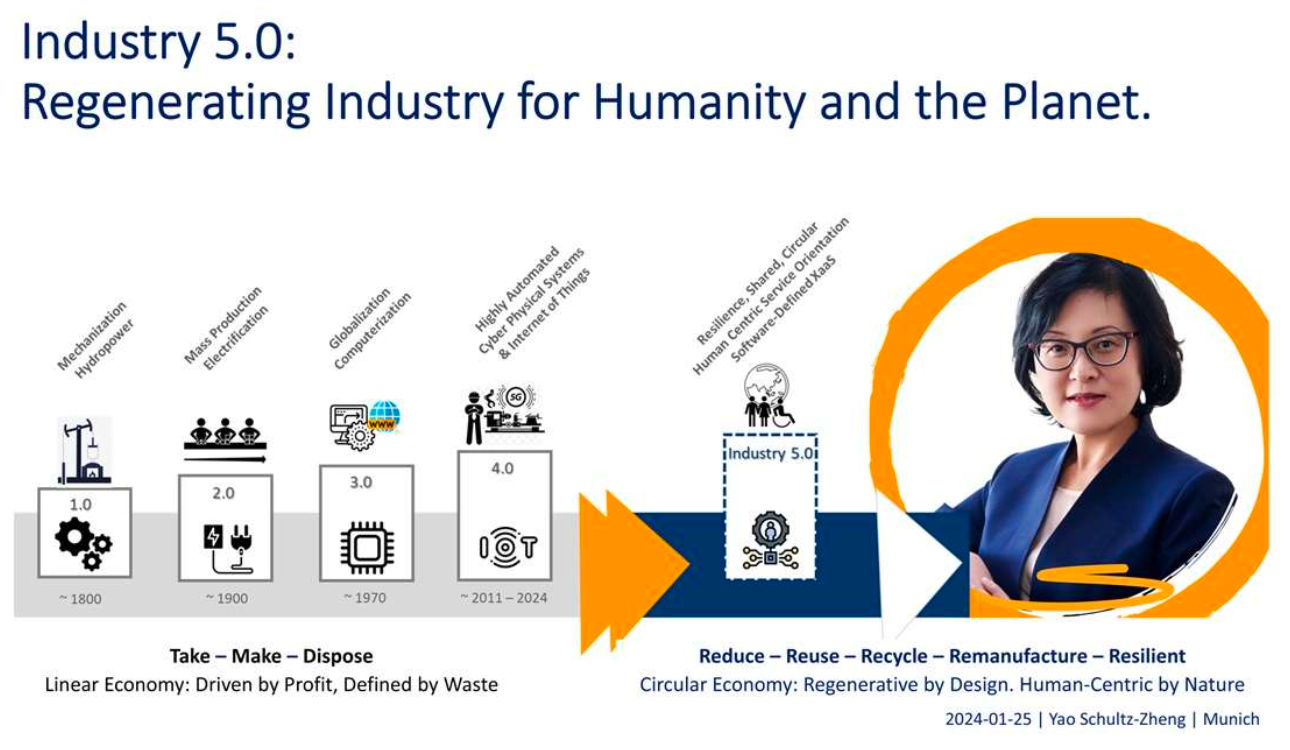Selbst, wenn CO2-Fußabdrücke ebenso wie andere Fußabdrücke vorbildlich reduziert werden und die ESG-Berichterstattung auch zu den weiteren vorgeschriebenen Themen exzellent funktioniert verbleibt ist nicht beantwortet, wie das Thema Nachhaltigkeit in der internen Organisation eines Unternehmens eingebettet sein sollte. Verschiedene Abteilungen bieten sich mit guten Gründen an: Der Einkauf, die Finanzbuchhaltung oder auch das Qualitätsmanagement stehen hier an erster denkbarer stelle. Ein Ansatz, den Springer gewählt hat, ist in dieser Richtung eine gute Vorlage: die zentral lokalisierte Carbon Bank. Dieses interne Team verwaltet zentral den Erwerb und die Verteilung von Emissionszertifikaten innerhalb des Unternehmens und prüft dabei noch die interne Erfolgsbilanz der betroffenen Abteilungen. Dieser Ansatz adressiert eine zentrale Herausforderung für Unternehmen bei der Integration von Nachhaltigkeitsthemen in die Organisation und ist in der Lage einen Teil der entsprechenden Prozesse auch finanziell messbar zu machen.
Eine Nachhaltigkeitsanalyse hat immer den Nachteil, dass sie insbesondere in den ersten Berichtszyklen kostenintensiv ist. Kosten, die ihre Ursachen am Anfang in externer Beratung und, wenn sich der Prozess und die Wege etabliert haben, in Personal und Organisation liegen. Die Organisation, die benötigt wird, um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen kostet am Anfang im unteren einstelligen Prozentbereich des Personalbudgets (wobei der Anteil mit größer werdenden Betrieben eher fällt). Das ist kostspielig. Unternehmen tendieren dazu in den ersten Berichtszyklen, weil der Prozess neu ist und weil er eine neue Sachkunde verlangt, eine separate Organisation aufzusetzen. Das ist zwar naheliegend, hat aber zur Folge, dass Schnittstellen neu geschaffen werden müssen, die zunächst nicht organisch in die Betriebsstrukturen eingebettet sind und damit Reibungsverluste verursachen.
Es stellt sich die Frage, welcher Abteilung die Berichterstattung zugeordnet wird:
Der finanzielle Bericht und der Nachhaltigkeitsbericht müssen eng verzahnt und abgestimmt sein. Beide sind rechtlich in der EU gleichbedeutend. Beide Berichte dürfen sich nicht widersprechen und haben Konsequenzen füreinander. Aus dieser Verpflichtung resultiert naheliegend der Organisationsansatz diese Berichterstattung in der Finanzabteilung aufzuhängen. Das Problem ist nur, dass die Finanzabteilung in der Regel keine Sachkunde was die technischen Prozesse und die Zulieferer hat. Zudem ist eine solche Organisationszuordnung nur dann sinnvoll, wenn das betreffende Unternehmen berichtspflichtig ist – also eine gewisse Größe (im Wesentlichen was Personal und Umsatz betrifft) überschreitet.
Ein anderer Ansatz hat eher technische Ursachen: Wenn der Produktionsstandort in der EU liegt und bei Produkten, die bereits eine lange Wertschöpfungskette hinter sich haben, liegen Ursachen der meisten zu berichtenden Nachhaltigkeitsthemen in der Lieferkette. Das bedeutet, dass der Einkauf mit seinen Kontakten zu den Zulieferern die naheliegende Organisationseinheit für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist: Dort laufen sowohl die relevanten Daten als auch die Nachhaltigkeitsberichte der Zulieferbetriebe natürlich zusammen, die Einkaufsabteilung kann, ebenso natürlich, mit den jährlichen Preisverhandlungen die Entwicklung der Fußabdrücke und aller anderen KPIs für das folgende Geschäftsjahr mit den Zulieferern verhandeln.
Langfristig gibt es noch einen weiteren Aspekt, der für den Einkauf spricht: Zwar liegen das Produktdesign und damit auch die Verantwortung für ein Ökodesign beim Produktmanagement und der Entwicklung, wenn aber geschlossene Wertschöpfungsketten und Recycling mit der Rückgabe an den Zulieferer angestrebt werden spielt auch hier der Einkauf eine zentrale Rolle, da er den Warenverkehr auch bei der Rückführung der zu recycelnden Güter koordinieren als auch den Wertefluss bewerten und bepreisen muss.
Ein dritter weniger populärer Ansatz könnte es sein die Berichterstattung an den Produkten, nahe dem Produktmanagement aufzuhängen. Dafür sprechen insbesondere die Kenntnis der Nutzungsszenarien und der Bedeutung der Fußabdrücke in den nachfolgenden Wertschöpfungsketten und dem praxisnahen Recycling. Dagegen spricht der offenbare Interessenkonflikt – das Bedürfnis das eigene Produkt und dessen Entwicklung schön zu reden.
Was machen Betriebe im Feld?
Um zu sehen wie das Thema heute gehandhabt wird bieten Nachhaltigkeitsberichte gute Anhaltspunkte. Hier werden die im Internet zugänglichen Nachhaltigkeitsberichte der Funke Mediengruppe und des Springer Verlages als Referenz genutzt. Beide sind auf ihre Weise sehr innovativ:
Springer hat bereits für das Geschäftsjahr 2005 einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Seit 2021 entsprechen die Berichte den internationalen Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Springer betreibt ein aktives Nachhaltigkeitsmanagement in allen Unternehmensbereichen mit dem klaren Ziel, die Netto-Emissionen auf null zu reduzieren (https://www.axelspringer.com/de/ax-press-release/axel-springer-veroeffentlicht-esg-report-fuer-2023). Diesem Ziel nähert sich Springer durch die schrittweise Reduzierung von Emissionen, insbesondere im Druckbereich, aber auch durch die Anwendung innovativer Managementmethoden. Vor allem ein organisatorischer Ansatz in der Arbeitsweise von Springer ist als besonders durchdacht angesehen - das, was Springer als Carbon Bankbezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Organisationseinheit, die für das gesamte Unternehmen CO2-Zertifikate vermittelt und intern abwickelt. Dies ist sowohl sinnvoll, um sicherzustellen, dass alle Teams und Einheiten dem gleichen Standard folgen, als auch erlaubt es, die jeweiligen Kosten zu reduzieren. Gleichzeitig ermöglicht dieser Organisationsschritt die Organisation eines Profit-Centers und damit Emissionskosten auch als Ansatz für interne Incentives zu nutzen. Eine solche Carbon Bank der Finanzabteilung zuzuordnen und auch mit dem Brokern von Optionen zu betrauen liegt nahe.
Die Funke Mediengruppe veröffentlicht vorbildliches Berichtswesen, das alle Aspekte des Unternehmens nach GRI abdeckt (https://www.funkemedien.de/files/allgemeine-downloads/nachhaltigkeitsbericht-funke-2023.pdf). In letzter Zeit ist Funke vor allem durch die sehr detaillierte Betrachtung aller beteiligten Wertschöpfungsketten aufgefallen. Natürlich hat Funke den Lebenszyklus des Papiers als größte Emissionsquelle für seine Druckprodukte identifiziert. Nach einer beispielhaften Detailanalyse der eigenen Druckprodukte und unter Einbeziehung aller Lieferanten hat Funke intern und bei den Lieferanten Möglichkeiten ausgemacht, insbesondere den CO2-Fußabdruck von Papier massiv zu reduzieren. Auch die anderen für die Nachhaltigkeit bedeutsamen KPIs wurden beachtet und werden reduziert. Die entsprechenden Maßnahmen entstanden in enger Kooperation mit den Zulieferern und zugeschnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen Druckprodukte bzw. deren Konsumenten.
Beide Herangehensweisen sind in ihrer Weise vorbildlich. Die Carbon Bank spricht für eine Organisation, die Nachhaltigkeit als Teil des internen Finanzwesens sieht (auch mit der Option Gewinne zu machen). Funkes Ansatz deutet eher auf eine Organisation nahe des Einkaufs hin. Beide Ansätze müssen auf der internen und engen Kooperation von Produktmanagement, Einkauf und Finanzwesen fußen. Wahrscheinlich ist es geschickt, die entsprechenden Prozesse in den ersten Berichtsjahren in Zusammenarbeit mit einem Berater aufzusetzen.